
Mozarts Symphonien Nr. 39 bis 41 gelten als Gipfelpunkte seines Instrumentalschaffens – und sind zugleich von Geheimnissen umrankt. Schuf der Komponist hier ein Vermächtnis, vielleicht sogar in Ahnung seines Todes? Manche Fragen hat die Wissenschaft inzwischen geklärt, anderes bleibt im Dunkeln.
Unbestritten hinreißende Meisterwerke sind seine drei letzten Symphonien Nr. 39 in Es-Dur, Nr. 40 in g-Moll und Nr. 41 in C-Dur mit dem Beinamen »Jupiter-Symphonie«. Doch sind sie mythen-umrankt: Für welchen Zweck sind sie komponiert worden? Hat Mozart überhaupt jemals eine Aufführung erlebt? Da dies alles nicht gesichert ist, legte sich die Biografik bald Geschichten zurecht.
Die romantische Vorstellung, dass sich Mozart durch eine Todesahnung gedrängt fühlte, gleichsam eine Quintessenz und Krönung seines symphonischen Schaffens aus sich herauszuschleudern, ist verführerisch – aber eine romantische Überhöhung. »Unter dem Namen des Schwanengesangs« sei die Symphonie Nr. 39 bekannt, schrieb 1810 E. T. A. Hoffmann. Und noch der verdienstvolle Mozart-Forscher Hermann Abert bemerkte 1920 den »tiefen, fatalistischen Pessimismus«, der vor allem aus der Symphonie Nr. 40 spreche.
Künstlerisches Testament …
Tatsächlich schrieb Mozart seine letzten drei Symphonien nicht kurz vor seinem Tod im Dezember 1791, sondern bereits im Sommer 1788. Laut seinem eigenhändigen Eintrag im »Verzeichnüß aller meiner Werke« entstanden sie innerhalb von nur acht Wochen, zwischen Nr. 40 und Nr. 41 liegen sogar nur 14 Tage – ein unfassbar kurz erscheinender Zeitraum, der aber gemessen an den Konventionen der Zeit und an Mozarts eigenen Gepflogenheiten durchaus nicht ungewöhnlich ist.
Schon im frühen 19. Jahrhundert gelangte Mozarts letzte Symphonie, die »Jupiter-Symphonie« (deren Beiname übrigens nicht von Mozart stammt), als »Symphonie mit der Schlussfuge« zu Berühmtheit. Die romantische Vorstellung, ein letztes Werk als Bilanz eines Œuvres zu betrachten, drängt sich hier geradezu auf. Denn die »Jupiter-Symphonie« steht nicht nur am Endpunkt von Mozarts symphonischem Schaffen, sondern sie führt diese Gattung – ein Kind des 18. Jahrhunderts – am Ende jenes Säkulums zu ihrem Gipfel.
Dabei ist es natürlich unwahrscheinlich, dass Mozart mit diesem Werk schon zwei Jahre vor seinem Tod, von dem er ja nicht wissen konnte, einen bewussten Schlusspunkt unter das Genre gesetzt hat. Dass er mit der »Jupiter-Symphonie« gar ein »künstlerisches Testament« für die Nachwelt hinterlassen habe, scheint völlig abwegig.
Mozarts verzweifelte Bemühungen um Aufführungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Einnahmen sprechen eine andere Sprache: 1788 ist das Jahr, in dem er die kühle Ablehnung des Wiener Publikums zu spüren bekam, es ist das Jahr seiner Bettelbriefe an den befreundeten Kaufmann Michael Puchberg. Dass er in einer solchen pekuniären Schieflage für die Schublade komponiert habe, widerspricht allem, was wir von seinem Pragmatismus und seiner Zeitökonomie wissen.
… oder einfach Geldsorgen?
Die These, dass die anspruchsvolle Trias der letzten drei Symphonien in jenem Jahr tatsächlich zur Aufführung kam, stützt der Musikwissenschaftler H. C. Robbins Landon auf einen leider undatierten Brief Mozarts an seinen Mäzen Puchberg. Hier kündigt er an, »Academien im Casino« – also öffentliche Konzerte – mit neuen Werken zu geben und ihm hierfür auch »mit 2 Billetts aufzuwarten«. Wenn dieser Brief tatsächlich im August 1788 geschrieben worden ist, wie verschiedene Forscher argumentieren, wäre dies ein Hinweis, dass die im Juni, Juli und August komponierten neuen Symphonien für ein Subskriptionskonzert im Herbst ganz frisch zur Verfügung gestanden hätten.
Für die Symphonie Nr. 40 haben Untersuchungen der Wasserzeichen auf den Blättern ergeben, dass die beiden erst nachträglich hinzugefügten Klarinettenstimmen auf demselben Papier niedergeschrieben wurden wie das ganze Werk. Es liegt also nahe, dass Mozart die Umarbeitung unmittelbar nach der Komposition vorgenommen hat, und zwar im Hinblick auf eine konkrete Aufführung.
2011 konnte die Musikwissenschaftlerin Milada Jonášová nachweisen, dass Mozart im Haus seines Gönners Baron Gottfried van Swieten eine Aufführung der g-Moll-Symphonie erlebte. Der Prager Musiker Johann Wenzel berichtete 1802 nämlich brieflich, dass er »vom verstorbenen Mozart« gehört habe, wie dieser das neue Werk bei van Swieten habe »producieren lassen«. Die Aufführung fiel jedoch offenbar so unerfreulich aus, dass Mozart »wärend der production aus dem Zimmer sich hat entfernen müssen, wie man Sie unrichtig aufgeführt hat«.
Dritte These: Auftragswerke
Baron van Swieten spielte nicht nur als Konzertmäzen eine Rolle im Wiener Musikleben. Er gab auch Werke in Auftrag. Und nicht zuletzt brachte er Mozart mit den Werken Bachs und Händels in Berührung. Hat van Swieten möglicherweise auch Mozarts drei letzte Symphonien beauftragt? Hat der erklärte Barockliebhaber vielleicht sogar die ausgefeilte Kontrapunktik angeregt, die im Finale der »Jupiter-Symphonie« demonstriert wird? Hier verschmolz Mozart alle Tricks aus dem kontrapunktischen Lehrbuch mit der Eleganz der klassischen Symphonik.
Auch bei Konzerten, die Mozart 1789 in Leipzig und Dresden sowie 1790 in Frankfurt a. M. gab, wurden Symphonien aufgeführt. Möglichweise hatte er seine neuesten Stücke im Gepäck. Belegt ist außerdem ein Wiener Konzert im April 1791, wo eine »große Sinfonie von der Erfindung des Hrn. Mozart« gespielt wurde – ausgerechnet unter der Leitung von Antonio Salieri, dem später als Rivale Mozarts aufgebauschten Komponisten.
Auf die Frage, ob die drei Werke von Mozart als Trias gedacht waren – etwa im Hinblick auf eine Drucklegung – gibt es bislang ebenfalls keine eindeutige Antwort. So spürt der Musikwissenschaftler Peter Gülke mit dem sprechenden Essaytitel »Im Zyklus eine Welt« der spekulativen Idee einer übergeordneten Einheit nach. Sein Kollege Volker Scherliess sieht dagegen das Individuelle der ganz unterschiedlich instrumentierten Werke: »Wollte man sie als zusammengehörige Werkgruppe auffassen, so wäre – paradox gesagt – ein Moment der Zusammengehörigkeit schon darin zu sehen, wie unterschiedlich sie im Einzelnen gestaltet sind«. Wie es sich für ein gutes Geheimnis gehört, lässt es aller wissenschaftlichen Akribie zum Trotz auch Raum für Fantasie und Gedankenflüge.

Johann Sebastian Bach und seine Söhne
Ein komponierender Sohn Johann Sebastian Bachs zu sein: Das war sicher eine ambivalente Situation ...
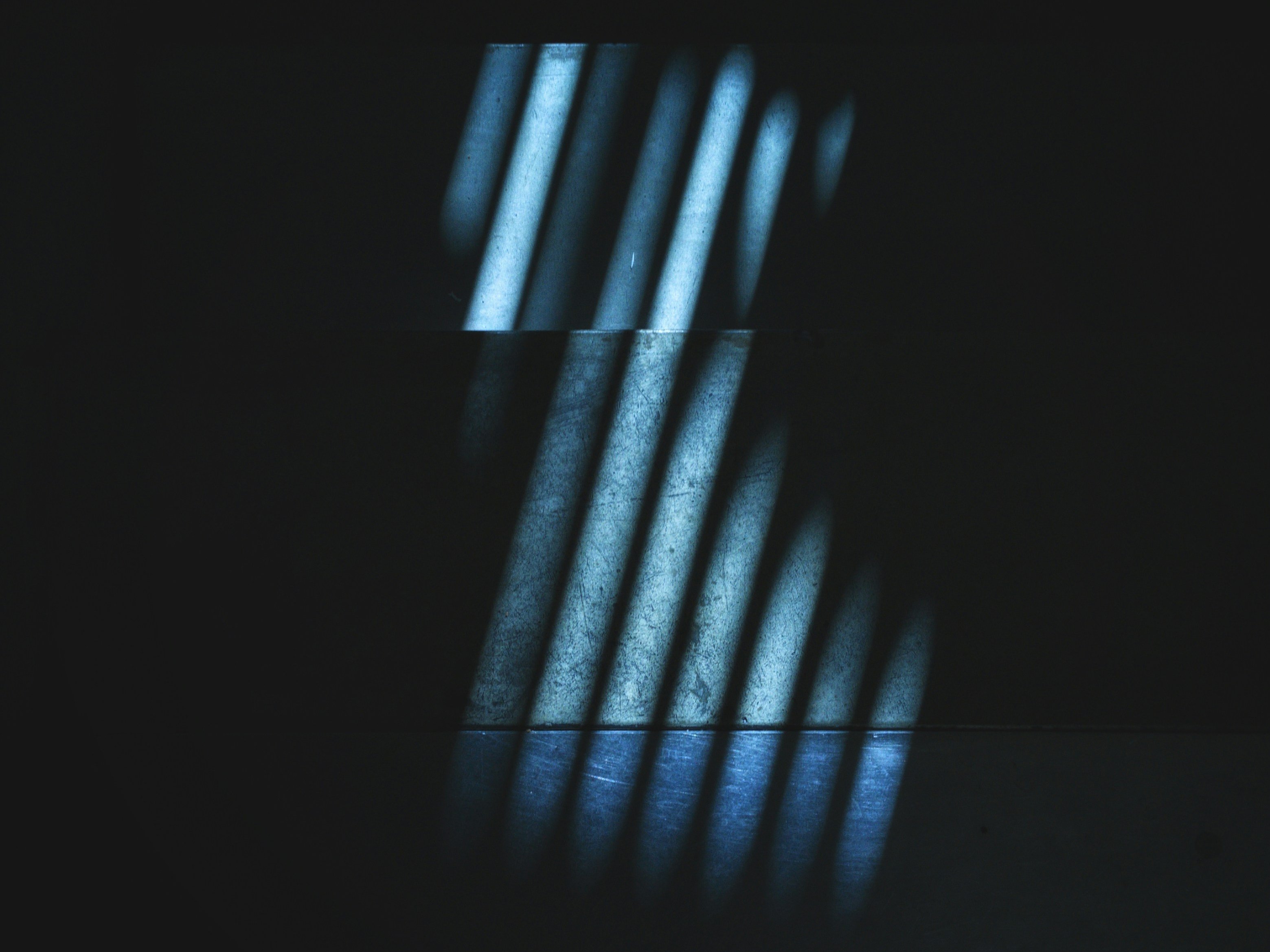
Witold Lutosławskis Erste Symphonie
Der polnische Komponist Witold Lutosławski gehörte zu den faszinierendsten Musikern seiner Zeit. Eine spannende Wiederentdeckung.

»Sturmflug unserer großen Zeit«
Mahler und der Weg der Symphonie ins Grandiose
