- Porträt
- Philharmonischer Moment

Der dänische Komponist Rued Langgaard war ein komischer Kauz, der mit seinen Mitmenschen meistens über Kreuz lag. Die Uraufführung seiner Ersten Symphonie durch die Berliner Philharmoniker am 10. April 1913 war ein philharmonischer Moment. Über ein Werk, das dringend einer Wiederentdeckung bedarf.
Dieses Konzert war – auch nach Meinung des Komponisten – der Höhepunkt seiner Karriere. Und zugleich der Schlusspunkt, leider. Denn Rued Langgaard war damals erst 19 Jahre alt, und es sollten 40 Jahre voller Niederlagen und Enttäuschungen folgen. Obwohl eine der originellsten Persönlichkeiten der europäischen Komponistenszene, blieb der Däne lebenslänglich ein Außenseiter, bestenfalls eine skurrile Figur, schlimmstenfalls ein bloßes Gerücht.
Dass er wirklich gelebt hatte, sprach sich in Dänemark erst nach 1968 herum, als Per Nørgård ein Stück seines Vorläufers zur Diskussion stellte; er schmuggelte Langgaards Sfærernes musik anonym in einen Kompositionswettbewerb, und die Mitglieder der hochkarätig besetzten Jury erklärten den Autor zu einem interessanten Epigonen György Ligetis, dessen Atmosphères von 1961 epochalen Rang genießt. Dann lüftete Nørgård jedoch die Karten: Voilà, dieses Stück hier ist von 1916! – woraufhin Ligeti erklärte: »Meine Herren! Ich habe soeben entdeckt, dass ich ein Langgaard-Epigone bin.«
Langgaard selbst hätte über diese Entdeckung wohl gestaunt, war er doch der Ansicht, seine Musik werde man erst in zweitausend Jahren verstehen! Aber nein, es ging viel schneller: das Radio sendete einige seiner bislang nicht aufgeführten 16 Symphonien, es erschienen mehrere Aufnahmen von Orchesterwerken, die Oper Antikrist feierte mit 80-jähriger Verspätung ihre Bühnenpremiere, und eine erste Biografie wurde veröffentlicht.
Ein Genie im Abseits
Warum Langgaard (1893–1952) zu Lebzeiten keinen Erfolg hatte? Seine erzromantische Ader war eigentlich kein Hindernis, da man im gemütlichen Dänemark alles liebte, was irgendwie vertraut klang. Das im gutbürgerlichen Kopenhagener Stadtteil Gammelholm behütet aufgewachsene Wunderkind passte ideal in dieses Milieu. Seine Begabung war phänomenal; noch in seinen letzten Lebensjahren konnte er Schumanns g-Moll-Sonate auswendig spielen, weil er sie in der Kindheit von der Mutter gehört hatte – die Partitur war ihm nie unter die Augen gekommen. Die Mutter leitete Chöre und erklärte jedem, der es nicht hören wollte, ihr Sohn sei ein Genie; der Vater schrieb ein nie aufgeführtes Klavierkonzert und Bücher für die Schublade, die Titel wie Über den Zusammenklang der Künste mit der Weltharmonie trugen.
Rued sog die christlich-spirituelle Kunstatmosphäre des Elternhauses auf und kultivierte sie bis an sein Lebensende. Das vollzog sich im Abseits, in einem Kaff an der jütländischen Westküste, wo der frustrierte Sonderling als Organist untergekommen war. Er hatte nie eine staatliche Schule besucht, sondern war daheim privat unterrichtet worden, seine Studien an der Hochschule hielten sich in engen Grenzen, sodass man ihn als Autodidakten bezeichnen kann. Die elitäre Erziehung und die vollständige Konzentration auf Musik führten dazu, dass Rued Langgaard isoliert lebte, den Nimbus der Erwähltheit pflegte und seine weltlich orientierten Zeitgenossen verdammte.
Schon in jungen Jahren, wird berichtet, habe er bei den wenigen Auftritten als Pianist keinen Applaus zur Kenntnis genommen, sondern dem Publikum den Rücken zugekehrt. Später nahm sein abweichendes Verhalten geradezu absurde Formen an. Langgaard schreckte vor keiner Beleidigung zurück, seine Urteile über andere Komponisten fielen denkbar schrill aus: Beethoven klinge wie eine Kuh am Klavier, Brahms rieche nach Bier und Zigarren, Nielsen sei reiner Humbug.
Den 28 Jahre älteren Nationalkomponisten erkor er sich zum Intimfeind und fand es noch 1948 erforderlich, Carl Nielsen, unser großer Komponist zu schreiben, ein 32 Takte langes Schmähstück für Orgel und Chor, das laut Manuskript »bis in alle Ewigkeit zu wiederholen« sei. 1945 komponierte er die Freie Klaviersonate, die Formverlauf und Spieldauer dem Pianisten anheimstellt.
Auch andere, bedeutend ältere Werke weisen auf John Cage und Co. voraus, etwa die Klaviersuite Insektarium von 1917, die den Pianisten auffordert, in die Saiten des Flügels zu greifen. Oft treffen wir auf minimalistische Strukturen, wie sie erst durch Steve Reich und Philip Glass populär wurden. Die Kombination mit einem spätromantisch exaltierten Ausdrucksgestus machte diese Innovationen allerdings für Avantgardisten ungenießbar. Auf deren Anerkennung legte Langgaard ohnehin keinen Wert. »Moderne Musik ist eine Pest« – mit ihr wollte er nichts zu tun haben.
Die Uraufführung in Berlin
In seiner 70-minütigen Ersten Symphonie, entstanden zwischen 1908 und 1911, fungiert die Musik noch nicht als göttliche Symbolsprache. Visionär und apokalyptisch geht es hier nicht zu, doch zelebriert der 19-jährige Komponist bereits emphatisch seine Liebe zu Schönheit und Harmonie. Einen Titel trug das Werk bei der Berliner Uraufführung noch nicht, Langgaard taufte es erst 1940 »Klippepastoraler«, also Klippenpastorale. Damit bezog er sich auf den Ort der Entstehung.
Er hatte über 35 Jahre lang, erst mit seinen Eltern und später dann mit seiner Ehefrau, jeden Sommer auf Kullen verlebt, einer hoch in den Öresund hineinragenden, felsigen schwedischen Halbinsel. Auch einige Orte dieser Küste – Arild, Helsingborg – dienten ihm als Bezeichnung für Werke, die die Stimmung vergangener, glücklicher Zeiten aufleben ließen.
Die zweifellos glücklichste Erinnerung galt seiner Ersten Symphonie. Ihre Uraufführung gestaltete sich schwierig, aber der Einsatz zahlte sich aus. Damals lebten Komponisten noch nicht von Auftragswerken – sie mussten selbst tief ins Portemonnaie greifen. Wie viel die Familie Langgaard für das prestigeträchtige Berliner Konzert hinlegte, ist nicht bekannt, aber man kann es sich in etwa vorstellen; Max Reger mokierte sich 1896 in einem Brief, der Konzertagent Hermann Wolff verlange 500 Mark für die Aufführung einer Novität durch die Berliner Philharmoniker.
Der Betrag dürfte 1913 nicht kleiner gewesen sein, jedenfalls ging es nur mithilfe der Unterstützung eines dänischen Tabakfabrikanten. Die frisch gekrönte dänische Königin Alexandrine immerhin übernahm die Schirmherrschaft. Rued Langgaard hatte sich vergeblich um Aufführungen in Kopenhagen und Stockholm bemüht. Als es ihm gelang, Arthur Nikisch und Max Fiedler die Handschrift zu zeigen und von beiden Dirigenten wärmste Anerkennung zu ernten, ergab sich eine ungeahnte Perspektive.
Tatsächlich offerierte dann das von Fiedler geleitete Orchester am 10. April 1913 in der alten Philharmonie ein reines Langgaard-Programm: zuerst ein Orgel-Präludium, gespielt vom Komponisten, dann das Tongemälde Sfinx und schließlich die große, fünfsätzige Symphonie h-Moll. Über tausend Zuhörer spendeten begeisterten Beifall, und in der dänischen wie deutschen Presse fand der Komponist vorbehaltlose Anerkennung. Gut möglich, dass dieser philharmonische Moment zu den wenigen Augenblicken gehörte, in denen Rued Langgaard die Außenwelt nicht nur als irrelevante Kulisse wahrnahm.

Der Sonderling
Anton Bruckner blieb zeitlebens ein Außenseiter in der feinen Gesellschaft Wiens. Wer war Bruckner und was trieb ihn an? Eine Spurensuche.
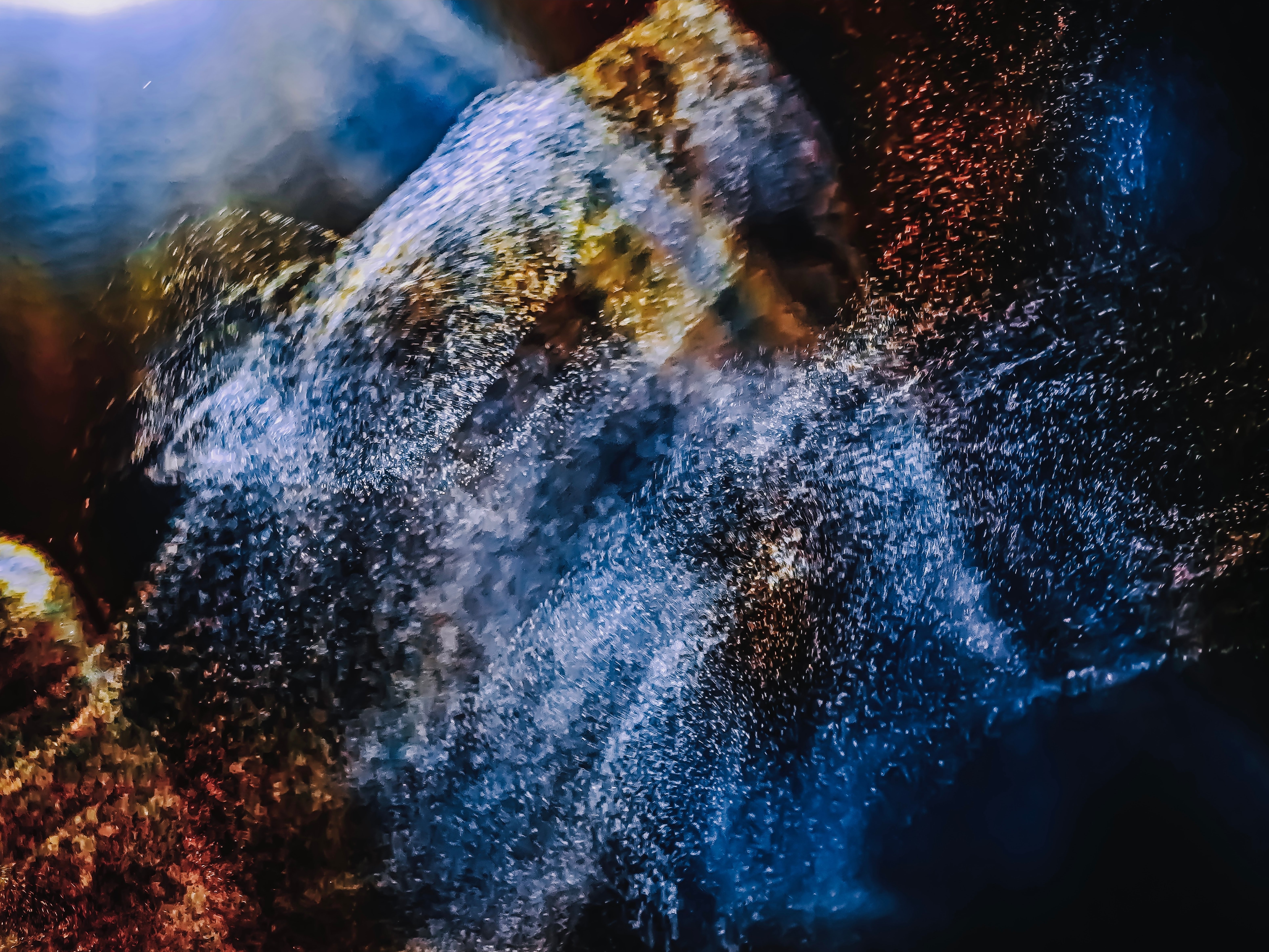
Neu entdeckt
Henri Dutilleux’ Erste Symphonie ist ein Meisterwerk

Erich Wolfgang Korngold
In den 1920er-Jahren gehörte Korngold zu den meistaufgeführten Komponisten seiner Zeit.